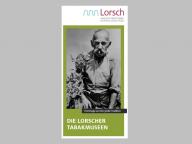Tabakmuseen
Tabakmuseum im Museumszentrum






Als das Tabakmuseum im Museumszentrum Lorsch 1995 eröffnet wurde, geschah das in dem Wissen darum, dass die Zeiten des Tabakanbaus und der Tabakverarbeitung auch in Lorsch zu Ende ging. 2017 folgte dann der Umbau des letzten verbliebenen Tabakschuppens zu einem Museum des Tabakanbaus. Nach einer über 300jährigen Geschichte war das auch eine Hommage an eine Pflanze, wie sie die heutige Stadt entscheidend prägte.
Das Tabakmuseum - eine Initiative des Heimat und Kulturvereins Lorsch
Das Museum zeigt auf zwei Etagen und etwa 500qm über 500 Objekte, die sich mit dem Tabakanbau, schwerpunktmäßig jedoch mit der Zigarrenherstellung und mit der Rauchkultur befassen. Die treibende Kraft bei der Entstehung und Gestaltung des Museums war der Heimat- und Kulturverein Lorsch HKV. Sowohl das Tabakmuseum als auch der 2017 als Museum des Tabakanbaus eröffnete Tabakschuppen werden von dem rührigen Verein betreut. Die Stadt finanziert das Museum und stellt die Liegenschaft.
Tabak: Von der Ritual- und Heilpflanze zum Todesboten
Lorsch liegt in der Metropolregion Rhein-Neckar, wo vor nun fast 450 Jahren
erstmals Tabak im heutigen Deutschland angebaut wurde, im südpfälzischen
Hatzenbühl. 1573 brachte der dort tätige Pfarrer Anselm Anselmann den Tabak aus
Lothringen mit und pflanzte ihn in seinen Pfarrgarten. Die dekorative Staude
diente ihm nicht nur zur Erbauung, sondern auch als Heilmittel.
Eher als Letzteres war der Tabak von dem französischen Gesandten
Jean Nicot aus Amerika in Europa eingeführt worden. Daher die Bezeichnung
„Nikotin“ für den wichtigsten Inhaltsstoff der Pflanze mit dem botanischen
Namen „Herba nicotiana“. Dort war der Tabak unverzichtbarer Bestandteil
spiritueller indianischer Rituale. Dabei wurde er gekaut, geschnupft, geraucht,
gegessen, entsaftet, auf dem Körper verrieben oder als Augentropfen und
Körperpackungen verwendet. Erst später wurde der Tabak auch als Genussmittel
bekannt, geschätzt und ist schließlich zur heutigen Zeit als todbringende Droge
geächtet.
Zur Geschichte des Tabaks in Lorsch
Gut einhundert Jahre nach Pfarrer Anselmanns Erstpflanzung beginnt die Geschichte des Tabaks im etwa 60
km nördlich davon gelegenen südhessischen Lorsch. Erstmals 1680 nachgewiesen,
pflanzte man auf den mageren Sandböden und begünstigt vom milden Bergsträßer
Klima die ursprünglich aus Südamerika kommende Pflanze an. Wie vielerorts hatte
der Dreißigjährige Krieg auch Lorsch entvölkert und die 800jährige
benediktinische Abtei endgültig zerstört. Nicht mehr 100 Menschen lebten noch
hier rund um die Ruinen des einstigen Reichklosters Karls des Großen.
Die Geschichte des Tabaks ist für Lorsch eine Erfolgsgeschichte
und bis heute das wichtigste Kapitel der Unternehmensgeschichte dieser Stadt,
deren wachsender Wohlstand auf Tabak gründet. Das Dorf beherbergte zwischen
1861 und 1983 insgesamt über 50 kleinere und 5 größere Zigarrenfabriken. 1880
wurden in Lorsch über 100 ha Tabak angebaut. Bei 3700 Einwohner bedeutet das,
dass nahezu jede Familie Tabak anbaute oder in der Zigarrenindustrie arbeitete. 1920 zur Hoch-Zeit der Zigarrenindustrie, gab es in Lorsch 200 Tabakbauern, die 50 ha Anbaufläche bearbeiteten.
Zwei Drittel der Arbeitsbevölkerung fand in Tabakanbau und –verarbeitung Lohn
und Brot.
Angebaut wurde - vor allem nach 1950 - Zigarettentabak. Aber hergestellt
wurden stets nur Zigarren. Der Tabak bot schon früh und erstmals Frauen die
Möglichkeit, ebenfalls Geld zu verdienen, was teilweise sogar die Löhne der
Männer übertraf. Von dem steigenden Familieneinkommen profitierten natürlich
ebenfalls Handwerk, Gewerbe und Handel in der Gemeinde. Die Geschichte des
Tabaks ist vor allem eine Geschichte des sozialen Wandels.
Doch wie überall in Deutschland erlosch nach dem Zweiten
Weltkrieg sowohl der Tabakanbau als auch die Zigarrenindustrie allmählich. 1983
schloss mit der Zigarrenfabrik Adam Neumann die letzte Zigarrenproduktion ihre
Pforten. Mit der Jahrtausendwende gab der letzte Tabakbauer auf. Schon Ende der
1970er Jahren begann man überall in der Stadt leerstehende Zigarrenmanufakturen
abzureißen um Wohnraum zu schaffen, was viele Zeitzeugnisse unwiederbringlich
vernichtete.
Was das Museum nahebringen will
Mit dem Niedergang des Tabaks konnten viele Exponate – weit über die Region
hinaus - für das Museum gewonnen werden, vor allem, was Ackergeräte und
Fabrikeinrichtungen betrifft.
Neben der eigentlichen Befassung mit Tabak wird sichtbar, welche
weiteren Gewerke und Zulieferbetriebe damit zusammenhingen (Stichwort Anzuchtbeete,
Handwagen, Trockengestelle, Tabakschneider, Wickeltische, Zigarrenformpressen, Zigarrenkisten,
Bauchbinden, Brandstempel, Verpackungsmaschinen etc.).
Das Museum versucht immer wieder in lebensnah gestalteten
Szenarien und mit Hilfe historischer Fotografien eine lebendige Vorstellung von
der damaligen Arbeit auf dem Feld und in der Fabrik zu geben. Dabei spiegelt
sich Verschiedenes wieder: die körperliche Anstrengung, die gesellschaftliche
Bedeutung und sozialen Auswirkungen, der Stolz der Unternehmer und der
Belegschaften, die Findigkeit technischer Verbesserungen und schließlich das
Lebensgefühl, dass der Tabakgenuss vermittelte.
Es geht jedoch auch um die Ursachen des Niedergangs der
Tabakkultur und dessen politische, wirtschaftliche und zeitgeistige Ursachen.
Natürlich wird dem Thema Rauchen und Gesundheit entsprechende Aufmerksamkeit
gewidmet.
Herausragendes
Auf
der sogenannten „Galerie“ sind in zwanzig Vitrinen die unterschiedlichsten
Utensilien rund um den Tabakgenuss ausgestellt. Es ist kunsthandwerklich
exzellent gefertigtes Zubehör rund um das Schnupfen und Kauen und natürlich im
Schwerpunkt um das Rauchen von Tabak. Ebenso gilt der Pflege der Zigarre viel
Aufmerksamkeit.
Das Museum hat unter anderem eine beachtenswerte Sammlung von
Zigarrenhaltern aus Meerschaum und eine umfangreiche Pfeifensammlung, u.a. die
größte rauchbare Pfeife der Welt. Ebenfalls im Guinessbuch der Rekorde wurde
die hier vorhandene Sammlung Manthe eingetragen. Sie ist mit 211 000
Bauchbinden und Deckelblättern für Zigarrenkisten die weltgrößte diesbezügliche
Sammlung. Schließlich steht Kennerinnen und Kennern auf Anfrage ein Archivraum
offen, der über tausend Grafiken, Stiche, Fotografien, Werbeplakate und
Zeitungsausschnitte beherbergt, die sich dem Thema widmen.
Das Loscher Tabakmuseum im Museumszentrum am UNESCO Welterbe
zeigt eine Pflanze und ihre vielfache und sehr unterschiedliche, ja
gegensätzliche Bedeutung im Laufe der Jahrhunderte.
Es macht das Thema Industriekultur und den Wandel von einer Agrar- zu einer
Produktionsgesellschaft in Deutschland lebendig und dessen tiefgreifende gesellschaftliche
Veränderungen anhand des Beispiels Lorsch sichtbar. Das Museum stellt Fragen,
scheut sich nicht davor, Missstände zu nennen, vermittelt aber auch die
Errungenschaften, die mentalitätsprägende Bedeutung und die enorme
Wirtschaftskraft, die der Tabak – exemplarisch in Lorsch – mit sich brachte.
Museum des Tabakanbaus im historischen Tabakschuppen



2017
wurde der letzte verbliebene Tabakschuppen auf Lorscher Gemarkung als Museum
des Tabakanbaus eröffnet und ergänzt damit inhaltlich die Präsentation des
Tabakmuseums in der Stadtmitte. Das hölzerne Gebäude ist denkmalgeschützt und
liegt etwa zehn Gehminuten östlich davon, nahe des Flüsschens Weschnitz, im
Areal des UNESCO Weltkulturerbes.
Einen authentischeren Ort wie den 50 m langen, 8 m breiten und
13 Meter hohen Holzbau könnte man dazu wohl nicht finden. In unmittelbarer Nähe
zu einem (seit 2013) wieder bebauten Tabakacker finden sich hier – direkt im
Sandboden - die Gerätschaften und Hilfsmittel, die die Tabakpflanzer
benötigten. 16 Ausstellungseinheiten auf zwei Etagen widmen sich dem Wachstum
und der Pflege der Tabakpflanze vom Ausbringen des gequollenen Samens bis zur
Fermentierung der getrockneten Blätter.
Auch hier wird sichtbar, dass die Tabakbauern und Tabakpflanzer
stets versuchte war, die Bedingungen sowie ihre Werkzeuge und Maschinen zu
optimieren. Die ältesten Objekte der Sammlung sind von 1880, die jüngsten von
2006. Im ersten Stock wurde vom Lorscher Tabakprojekt Tabak zu Trocknen
aufgehängt, sodass Gäste im Idealfall die grüne oder gar blühende, bis zu drei
Meter hohe Pflanze auf dem Acker und die im Jahr zuvor eingebrachte Ernte im
Schuppen besichtigen können. Die unversehrte Konstruktion des Ständerbaus,
dessen Außenhaut aus beweglichen Brettern (sogenannte Lamellen) besteht, zeigt
auch die ausgeklügelte, per Hand steuerbare Bauweise, die der optimalen
Trocknung der Blätter dient.
Neben den landwirtschaftlichen Gerätschaften befinden sich viele
Fotos und multimediale Stationen in dem Schuppen. Bild- und Tondokumente,
darunter etliche kurze Filmsequenzen, machen zusätzlich das landwirtschaftliche
Leben und seinen Wandel rund um den Tabakanbau deutlich.
Aus Witterungsgründen ist der Tabakschuppen nur von Ostern/Mitte
März bis Ende Oktober geöffnet. Das Museum ist nur mit Führungen zugänglich.
Tabakmuseum im Museumszentrum
Nibelungenstraße 35
64653 Lorsch
Tel. 0 62 51/10 38 20
Öffnungszeiten
DI – SO 10.00 - 17.00 Uhr
Alle unsere Einrichtungen bleiben am 24., 25. und 26. DEZ, am 31. DEZ und 1. JAN sowie an Fastnachtsdienstag geschlossen.
Preis
3 € | 2 € (ermäßig) |
Familienkarte (2 Erw. bis 4 Kinder) 7 € | Gruppen ab 20 Personen 2 € p.P.
Führungen für Gruppen bis 10 Personen: 70 € | jede weitere Person 7 € (inkl.
Museumseintritt)
Kontakt und Buchung
Touristinfo NibelungenLand
Tel. 0 62 51/17 52 60
www.nibelungenland.net
Museum des Tabakanbaus im historischen Tabakschuppen
Im Klosterfeld 13
64653 Lorsch
Öffnungszeiten
Mitte März bis Ende Oktober. Zugänglich nur mit Führung (ohne Führung nur am
Tage der Offenen Tür am Johannisfest-Sonntag und am Kerwe-Sonntag)
Führungen für Gruppen bis 10 Personen: 70 € | jede weitere Person 7 €
Alle unsere Einrichtungen bleiben am 24., 25. und 26. DEZ, am 31. DEZ und 1. JAN sowie an Fastnachtsdienstag geschlossen.
Kontakt und Buchung
Touristinfo NibelungenLand
Tel. 0 62 51/17 52 60
www.nibelungenland.net
Weitere Informationen
www.kulturverein-lorsch.de/index.php/tabakmuseum